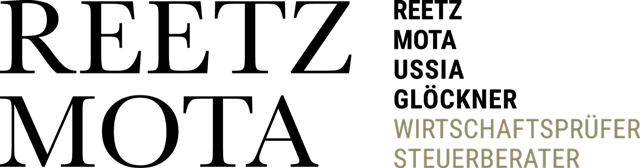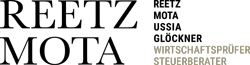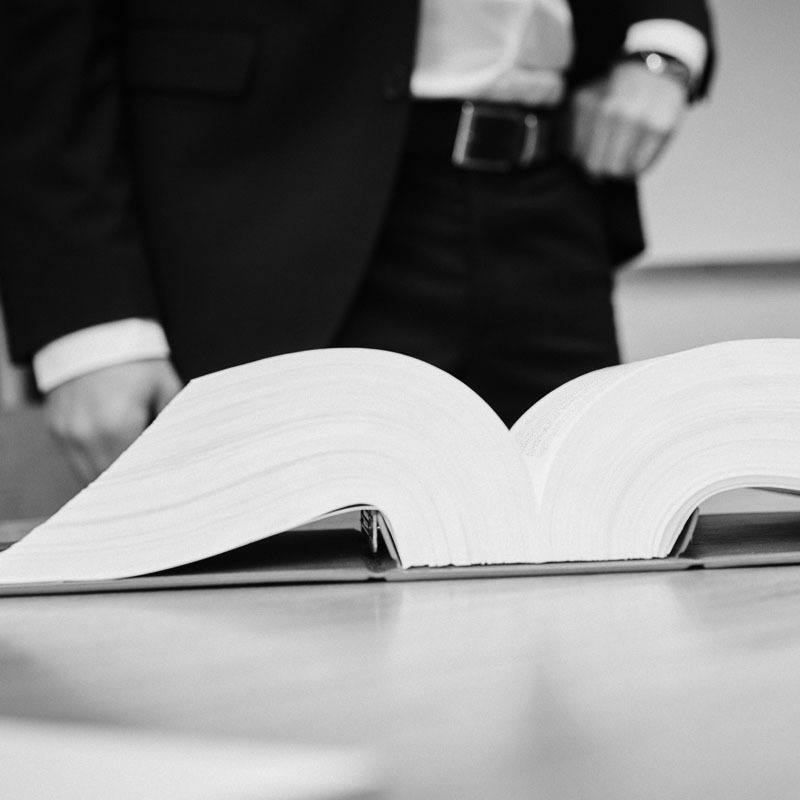Als besonderen Service haben wir fachliche Informationen aus Wirtschaft und Steuerrecht zusammengefasst, da sie für viele unserer Mandanten relevant sind:
Aktuelles aus Wirtschaft und Steuerrecht
Leicht verständlich für Sie aufbereitet
- Kleinunternehmer-Besteuerung gemäß § 19 UStG
- Umsatzsteuerliche Organschaft
- Ordnungsgemäße Kassenführung
- Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung
- Mini-One-Stop-Shop – MOSS
- Private Steuerberatungskosten
- Regelungen zur geringfügigen Beschäftigung (Minijobs)
- Steuerliche Behandlung des Unternehmerfahrzeugs
- Möglichkeiten der Gewinnermittlung für Gewerbetreibende und Freiberufler
- Vorträge/Lehrtätigkeit Maik Reetz und Marcus Mota: Schulungsunterlagen für kommunale Jahresabschlussprüfer und Kämmerer
Mehr
Unternehmer
1. Fiskalvertretung:
Neue Erklärungspflichten
Ausländische Unternehmer können seit dem 01.01.1997 unter bestimmten Voraussetzungen in Deutschland einen Fiskalvertreter bestellen und sich von diesem bei der Erfüllung der umsatzsteuerrechtlichen Pflichten vertreten lassen. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zu dieser Thematik ein Schreiben veröffentlicht und in diesem Zusammenhang den Umsatzsteuer-Anwendungserlass umfassend geändert.
Durch das Jahressteuergesetz 2019 wurden die Regelungen zur Fiskalvertretung (§ 22a bis 22e Umsatzsteuergesetz) überarbeitet und mit Wirkung zum 01.01.2020 geändert. Fiskalvertreter sind nach § 22b UStG nunmehr verpflichtet,
neben der Umsatzsteuerjahreserklärung auch vierteljährliche Umsatzsteuer-Voranmeldungen abzugeben. Zudem haben sie der Umsatzsteuerjahreserklärung als Anlage eine Aufstellung beizufügen, die die von ihnen vertretenen Unternehmer mit deren jeweiligen Besteuerungsgrundlagen enthält. Des Weiteren haben sie Zusammenfassende Meldungen nach Maßgabe des § 18a UStG abzugeben. Sofern der Fiskalvertreter diesen Erklärungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, kann gegen ihn ein Zwangsmittel oder ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden.
In seinem aktuellen Schreiben geht das BMF auch auf die Befugnis zur Fiskalvertretung, die Bestellung des Fiskalvertreters, den Ausschluss der Fiskalvertretung, das Ende der Fiskalvertretung und die Folgen der Beendigung der Fiskalvertretung ein.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle offenen Fällen anzuwenden.
2. Aktualisierte Liste:
Umsatzsteuervergünstigungen für NATO-Hauptquartiere
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 09.10.2023 ein Schreiben zu den Umsatzsteuervergünstigungen aufgrund des Ergänzungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere veröffentlicht. Bereits mit Schreiben vom 08.08.2017 hatte die Finanzverwaltung aufgelistet, was als NATO-Hauptquartier definiert wird. Mit Schreiben vom 08.02.2021 wurde das „Standing Joint Logistics Support Group Headquarters, Ulm“ als NATO-Hauptquartier anerkannt und die Liste entsprechend vervollständigt. Weitere Aktualisierungen gab das BMF mit Schreiben vom 25.01.2022 sowie vom 28.04.2023 bekannt. Im aktuellen Schreiben vom 09.10.2023 wurde die Liste nun nochmals aktualisiert.
Im Zusammenhang mit NATO-Hauptquartieren sind umsatzsteuerliche Besonderheiten zu beachten. Geschäfte mit bestimmten NATO-Hauptquartieren in Europa können von der Umsatzsteuer befreit werden. Für die Gewährung der Umsatzsteuerbefreiung sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.
NATO-Hauptquartiere können Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Hauptquartier ausführt, sowie Lieferungen und sonstige Leistungen an ein Hauptquartier unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreien. Dies ist im Ergänzungsabkommen zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere geregelt. Das BMF weist darauf hin, dass die Voraussetzungen für diese Umsatzsteuerbefreiungen im Wesentlichen den Voraussetzungen für die Umsatzsteuerbefreiung nach dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut entsprechen.
Hinweis: Das aktuelle Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 25.01.2022 in der Fassung des BMF-Schreibens vom 28.04.2023.
3. Ermäßigter Steuersatz:
Kurzfristige Vermietung von Wohncontainern
Das Bundesfinanzministerium hat ein aktuelles Schreiben zum Steuersatz bei der kurzfristigen Vermietung von Wohn- und Schlafräumen herausgegeben. Im Umsatzsteuergesetz ist geregelt, dass bei Umsätzen aus der kurzfristigen Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur Beherbergung von Fremden bereithält, sowie aus der kurzfristigen Vermietung von Campingflächen der ermäßigte Steuersatz anzuwenden ist.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte bereits im Jahr 2022 entschieden, dass nicht nur die Vermietung von Grundstücken und mit diesen fest verbundenen Gebäuden begünstigt ist, sondern allgemein die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen durch einen Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden und damit auch die Vermietung
von Wohncontainern an Erntehelfer. Die Finanzverwaltung übernimmt mit ihrem aktuellen Schreiben die
BFH-Rechtsprechung und passt in diesem Zusammenhang den Umsatzsteuer-Anwendungserlass an.
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Aus Gründen des Vertrauensschutzes wird es (auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers) nicht beanstandet, wenn sich der leistende Unternehmer für bis zum 31.12.2023 ausgeführte Leistungen auf die Anwendung des Regelsteuersatzes beruft.
4. Ferienimmobilien:
Zahlungen des Ferienanbieters können gewerbesteuerlich hinzuzurechnen sein
Bei der Berechnung der Gewerbesteuer muss der steuerliche Gewinn des Gewerbetriebs zunächst um verschiedene gewerbesteuerliche Hinzurechnungen erhöht und um gewerbesteuerliche Kürzungen vermindert werden, so dass sich der Gewerbeertrag ergibt – die maßgebliche Rechengröße für die weitere Gewerbesteuerermittlung. Hinzuzurechnen ist beispielsweise ein Teil der Miet- und Pachtzinsen, die ein Gewerbetreibender für die Benutzung von fremden unbeweglichen Wirtschaftsgütern (z.B. Gebäuden) zahlt.
Hinweis: Über diese Hinzurechnungsregel will der Gesetzgeber Nutzer fremder Wirtschaftsgüter mit selbstnutzenden Eigentümern vergleichbarer Wirtschaftsgüter gleichstellen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass auch solche Aufwendungen als Mieten hinzuzurechnen sein können, die ein Ferienimmobilienanbieter tätigt, damit ihm die Immobilieneigentümer die Ferienunterkünfte zur Vermietung an Reisende überlassen. Geklagt hatte ein Anbieter, der mit seinen Reisekunden in eigenem Namen und für eigene Rechnung Ferienhaus- und Ferienwohnungsverträge abgeschlossen hatte – und zwar zu einem Gesamtpreis, in dem der zu zahlende Preis an den jeweiligen Immobilieneigentümer und ein Aufschlag (Marge) für den Anbieter enthalten waren. Das Finanzamt kam nach einer Außenprüfung zu dem Ergebnis, dass es sich bei den vom Anbieter an die Eigentümer gezahlten Entgelten um Mieten handelte, die dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen sind.
Der BFH bestätigte die Hinzurechnung und erklärte, dass eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Mietzinsen einen Nutzungsvertrag voraussetzt, der nach seinem wesentlichen rechtlichen Gehalt ein bürgerlich-rechtliches Mietverhältnis ist. Dies war nach Gerichtsmeinung vorliegend der Fall, da die Hauptleistungspflicht der Eigentümer in der Gebrauchsüberlassung der Ferienimmobilien und die Hauptleistungspflicht des Anbieters wiederum in der Zahlung eines Mietzinses bestanden hatte. Zwar kann ein Ferienimmobilienanbieter auch bloß als Vermittler zwischen den Eigentümern und den Reisenden tätig werden. Der Anbieter im vorliegenden Fall war jedoch kein bloßer Vermittler, da er eine Vielzahl von Objekten im eigenen Namen angeboten hatte, ohne auf den jeweiligen Eigentümer des Ferienobjekts hinzuweisen. Zudem hatte der Anbieter gegen die Ferienimmobilienanbieter keine Provisionsansprüche, sondern musste den Eigentümern vielmehr ein Entgelt für die Überlassung der Objekte zahlen.
5. Statistik zu Betriebsprüfungen:
1,8 % aller Betriebe wurden im Jahr 2022 geprüft
Wie oft Selbständige und Gewerbetreibende einer Betriebsprüfung unterzogen werden, hängt von der Größe des
Unternehmens, der wirtschaftlichen Zuordnung und der Art des Betriebs ab. Das Finanzamt unterscheidet zwischen
Groß-, Mittel-, Klein- und Kleinstbetrieben. Dabei gilt die Faustregel: Je größer das Unternehmen ist, desto häufiger wird es zu einer Außenprüfung kommen. Während Großbetriebe in aller Regel durchgehend und lückenlos mit sämtlichen Besteuerungszeiträumen geprüft werden, müssen Klein- und Kleinstbetriebe eher selten mit einer Prüfung rechnen. Viele dieser Betriebe sind jahrzehntelang überhaupt keiner Betriebsprüfung ausgesetzt. Bei ihnen werden Betriebsprüfungen häufig anlassbezogen angeordnet, beispielsweise wenn Unstimmigkeiten in den Gewinnermittlungen zu Tage treten.
Hinweis: Als Klein- oder Kleinstunternehmer kann man zudem dann in den Fokus des Finanzamts geraten, wenn man einer bestimmten Branche angehört, die schwerpunktmäßig geprüft wird, wenn Kontrollmitteilungen aus einer Betriebsprüfung eines Geschäftspartners beim Finanzamt eingegangen sind oder (anonyme) Anzeigen vorliegen.
Nach einer neuen Statistik des Bundesministeriums der Finanzen über die steuerlichen Betriebsprüfungen der Länder wurden im Jahr 2022 von insgesamt 8.409.661 registrierten Betrieben insgesamt 151.676 geprüft. Das entspricht einer Prüfungsquote von 1,8 %. Bei Großunternehmen lag die Quote bei 17,5 %, bei mittelgroßen Betrieben bei 4,8 %, bei Kleinbetrieben bei 2,4 % und bei Kleinstbetrieben bei 0,8 %. Insgesamt 12.949 Betriebsprüfer waren dafür im Einsatz.
Hinweis: Das erzielte steuerliche Mehrergebnis der Prüfungen lag bei rund 10,8 Mrd. €, davon entfielen allein 7,8 Mrd. € auf die Prüfung von Großbetrieben.
6. Laut Urteil zulässig:
Vorsteuerabzug bei Erschließung eines Gewerbegebiets
Das Finanzgericht Münster (FG) hat entschieden, dass eine kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vorsteuern aus der Erschließung eines Gewerbegebiets abziehen kann. Geklagt hatte eine GmbH, an der eine Stadt zu 85 % und eine Bank zu 15 % beteiligt sind. Der Zweck der GmbH besteht darin, im Gebiet der Stadt neue Gewerbegebiete zu erschließen und deren Baureife herzustellen. Dazu brachte die Stadt in ihrem Eigentum stehende Grundstücke in die GmbH unter der Bedingung ein, dass diese die Grundstücke als Gewerbeflächen erschließt. Die Stadt übertrug die Erschließung des Baugebiets auf die GmbH. Nach erfolgter Erschließung veräußerte die GmbH die Grundstücke an verschiedene Unternehmer. Hierbei optierte sie zur Umsatzsteuerpflicht.
Das Finanzamt versagte der GmbH den Vorsteuerabzug für die in den Jahren 2014 bis 2016 hergestellten Erschließungsanlagen. Es vertrat die Auffassung, dass diese Anlagen durch die öffentliche Widmung unentgeltlich auf die Stadt übertragen worden seien, und sah keinen wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Grundstücksverkäufen. Andernfalls läge eine Wettbewerbsverzerrung vor, da die Stadt die Grundstücke auch selbst hätte erschließen und veräußern können, ohne einen Vorsteuerabzug zu erhalten.
Hiergegen wehrte sich die Klägerin, und zwar mit Erfolg. Die Herstellung der Erschließungsanlagen hängt ihrer Ansicht nach mit den steuerpflichtigen Grundstücksveräußerungen zusammen, weil die Veräußerungen ohne die Erschließung nicht möglich gewesen wären. Dem folgte das FG. Die GmbH habe die Durchführung der Erschließung als Gegenleistung für die Übertragung der Grundstücke von der Stadt im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes erbracht. Als Auflage habe sie sich verpflichtet, die Erschließung des Baugebiets durchzuführen. Zwischen dieser Auflage und der Grundstücksübertragung von der Stadt habe ein unmittelbarer Zusammenhang bestanden.
Unabhängig vom Vorliegen eines tauschähnlichen Umsatzes sei im Hinblick auf einen Großteil der Kosten ein Vorsteuerabzug zu gewähren, da diese als allgemeine Kostenelemente ihrer umsatzsteuerpflichtig an die Gewerbetreibenden gelieferten Grundstücke anzusehen seien. Für die wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerin sei die Erschließung des Gewerbegebiets unerlässlich gewesen.
7. Aufarbeitung von Gebrauchtgegenständen:
Differenzbesteuerung auch bei Upcycling anwendbar?
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob die Differenzbesteuerung auch dann anwendbar ist, wenn ein Gebrauchtgegenstand nicht nur aufgearbeitet, sondern zugleich zum Zweck seiner zeitgemäßen Nutzung um ein Neuteil ergänzt wird.
Im Urteilsfall hatte die Klägerin antike Waschkommoden aus privater Hand angekauft, restauriert und zusammen mit einem individuell angepassten Waschbeckenaufsatzteil nebst Armatur wiederverkauft. Das Finanzamt versagte die Anwendung der Differenzbesteuerung, da im Ergebnis ein neuer Verkaufsgegenstand hergestellt worden sei. Die Klägerin vertrat hingegen die Auffassung, dass die Funktion des Objekts als Waschkommode unverändert geblieben sei. Das Neuteil spiele bei der Gesamtwürdigung der Restaurierungsarbeiten und auch hinsichtlich des Kaufmotivs der Kunden nur eine untergeordnete Rolle.
Das FG gab der Klägerin recht und bezog sich dabei insbesondere auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sowie des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2017. Die erforderliche Identität zwischen Ankaufs- und Verkaufsobjekt sei mit Blick auf den Normzweck der Differenzbesteuerung (Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen und Doppelbesteuerungen bei der Wiedereinführung von Gebrauchtgegenständen in den Wirtschaftskreislauf) nicht zu eng auszulegen. Daher sei die Differenzbesteuerung nicht allein auf Recyclingfälle beschränkt. Sie könne auch in den Fällen der Verbindung eines aufgearbeiteten Gebrauchtgegenstands mit einem Neuteil (Upcycling) zur Anwendung kommen.
Voraussetzung sei, dass der aufgearbeitete Gebrauchtgegenstand dem Wiederverkaufsobjekt sein Gepräge gebe und aus Verbrauchersicht das entscheidende Kaufmotiv darstelle.
8. Aufteilungsmaßstab:
Gewinnaufteilung bei länderübergreifender Wirtschaftstätigkeit
Jede Gemeinde legt ihren Gewerbesteuerhebesatz selbst fest. Das kann dazu führen, dass zwei Unternehmen mit gleich hohem Gewinn je nach Standort unterschiedlich hohe Gewerbesteuer zahlen. Wenn ein Unternehmen über mehrere Gemeinden hinweg tätig ist, muss der Gewinn auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt werden. Sind nicht nur unterschiedliche Gemeinden, sondern auch mehrere Länder beteiligt, kann das noch komplizierter werden, zumal wenn es hierbei auch um steuerfreie Gewinne geht. In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Düsseldorf (FG) ging es darum, die Gewinne aus einem länderübergreifenden Rohrfernleitungsnetz aufzuteilen.
Die Klägerin betreibt ein Rohrfernleitungsnetz. Außerdem erzielt sie ca. 1 % ihres Gesamtumsatzes durch die Betreuung fremder Rohrfernleitungen. Die Rohrleitungen verlaufen durch Deutschland, Belgien und die Niederlande. Bis auf ein Teilstück in Belgien steht diese Infrastruktur im Eigentum der Klägerin. Die Verwaltungszentrale befand sich im Streitjahr in Deutschland. Die operative Steuerung erfolgt durch eine „Betriebszentrale“ in den Niederlanden. Bei einer Betriebsprüfung bestimmte das Finanzamt den auf die Niederlande und Belgien entfallenden Gewinnanteil danach, welche Einkünfte bei einer unmittelbaren Nutzung (Vermietung) der Rohrleitung erzielt worden wären. Die Aufteilung der Einkünfte habe nach der direkten Methode zu erfolgen, da das Stammhaus und die sonstigen Betriebsstätten in Form der Rohrleitungen unterschiedliche Funktionen ausübten.
Die Klage vor dem FG war begründet. Die vom Finanzamt vorgenommene Gewinnaufteilung sei nicht konform mit den Doppelbesteuerungsabkommen. Der Gewinn der Klägerin sei daher anders aufzuteilen. Maßgeblich für die Verteilung des Gewinns auf die einzelnen Länder sei, welchen Gewinn die beiden ausländischen Betriebsstätten erzielt hätten, wenn sie die zu ihrem Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter – also die durch Belgien bzw. die Niederlande
verlaufenden Teile der Rohrleitungen – als eigenständige Unternehmen bewirtschaftet hätten. Somit sei die Aufteilung danach vorzunehmen, mit welchem Teil des Rohrleitungsnetzes welcher Umsatz erzielt worden sei. Als Konsequenz hieraus ist im Streitfall der inländische Anteil des Gesamtgewinns zu reduzieren, wodurch sich der nach den Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreie Anteil erhöht.
9. Bundesfinanzministerium:
Vorabhinweise zur elektronischen Rechnung
Mit dem Wachstumschancengesetz werden die Regelungen zur Einführung der elektronischen Rechnung für inländische B2B-Umsätze im Umsatzsteuergesetz verankert. Bereits vor Abschluss des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens hat das Bundesfinanzministerium (BMF) erste Hinweise zu den Anforderungen an eine elektronische Rechnung verlautbaren lassen. Fraglich war, ob die bereits bekannten Formate XRechnung und ZUGFeRD die geplanten Vorgaben erfüllen. Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) informiert nun über das diesbezügliche Entwurfsschreiben des BMF.
Eine elektronische Rechnung soll nach aktuellem Sachstand eine Rechnung sein, die in einem strukturierten
elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Sie muss der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung und der Liste der entsprechenden Syntaxen
entsprechen.
Das BMF stellt klar, dass sowohl eine Rechnung nach dem bekannten XStandard als auch im ZUGFeRD-Format ab Version 2.0.1 grundsätzlich eine Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format darstellt, die den geplanten
Anforderungen entspricht. Dies ist laut Verband ein wichtiger Hinweis für die Praxis, der die Planungssicherheit erhöht.
Zudem äußert sich das BMF zum Einsatz des EDI-Verfahrens: Es werde aktuell an einer Lösung gearbeitet, um das EDI-Verfahren auch unter dem künftigen Rechtsrahmen weiterhin nutzen zu können. Das Erfordernis technischer Anpassungen könne allerdings nicht ausgeschlossen werden. Man sei aber bemüht, den Umstellungsaufwand auf das Notwendige zu begrenzen.
Laut Regierungsentwurf ist zwar eine gestaffelte Übergangsregelung für die Pflicht zum Ausstellen einer elektronischen Rechnung vorgesehen. Das BMF weist jedoch vorsorglich darauf hin, dass ab dem 01.01.2025 alle Unternehmer verpflichtet sein werden, elektronische Rechnungen entgegennehmen zu können.
Hinweis: Der DStV hatte sich bereits mit diversen Stellungnahmen in die Diskussion um die Einführung der elektronischen Rechnung eingebracht. Er begrüßt das Ansinnen des BMF, frühzeitig Rechts- und Planungssicherheit schaffen zu wollen.
10. Gastronomie ab 01.01.2024:
Umsatzsteuersatz springt auf 19 % zurück
Um die Gastronomie während der Corona-Pandemie zu stützen, hatte der Gesetzgeber den Umsatzsteuersatz auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen ab dem 01.07.2020 von 19 % auf 7 % abgesenkt. Ausgenommen hiervon waren lediglich Getränke. Die Regelung ist zum 31.12.2023 ausgelaufen und wurde nicht verlängert.
Ein dauerhaft ermäßigter Umsatzsteuersatz von 7 % auf den Verzehr von Speisen in Restaurants hatte im September 2023 keine Mehrheit im Bundestag gefunden. Ein entsprechender Entwurf der CDU/CSU-Fraktion zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes war abgelehnt worden. Vonseiten der CDU/CSU-Fraktion war die Verlängerung der Umsatzsteuerermäßigung mit durch die Corona-Pandemie eingetretenen Verhaltensänderungen der Verbraucher begründet
worden. Es wurde argumentiert, dass die Verbraucher verstärkt geliefertes oder mitgenommenes Essen konsumieren würden, das dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegt.
Mit der Senkung sollten Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden und steigende Belastungen der Gastronomiebetriebe durch hohe Energie- und Einkaufspreise kompensiert werden. Im Ergebnis konnten die vorgebrachten Argumente für eine Entfristung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie im Bundestag jedoch nicht überzeugen. In der öffentlichen Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass die Post-Pandemie-Zeit auch anderen Branchen einen weiteren Strukturwandel zumutet und keine Rechtfertigung für eine dauerhafte Subventionierung der Gastronomiebranche bestehe.
Ärzte und Heilberufe
11. BMF-Schreiben:
Umsatzsteuerbefreiung für Laborleistungen
Das Bundesfinanzministerium hat ein Schreiben zur Umsatzsteuerbefreiung von Laborleistungen herausgegeben. Es reagiert damit auf die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und hat in diesem Zusammenhang den Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.
Bereits im Jahr 2017 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass medizinische Analysen, die von einem in privatrechtlicher Form organisierten Labor außerhalb der Praxisräume des praktischen Arztes durchgeführt werden, der sie angeordnet hat, nach § 4 Nr. 14 Buchst. b Umsatzsteuergesetz (UStG) steuerfrei sein können, nicht aber auch nach Buchstabe a dieser Vorschrift. Nach einem Urteil des EuGH aus dem Jahr 2019 gilt diese Rechtsprechung des BFH jedoch zwischenzeitlich als überholt.
Laut EuGH können medizinische Analysen eines Facharztes für klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik nicht nur nach § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG, sondern auch nach § 4 Nr. 14 Buchst. a Satz 1 UStG steuerfrei sein. Das Bestehen eines Vertrauensverhältnisses zwischen Behandelndem und Patient sei keine Voraussetzung für die Steuerbefreiung einer Tätigkeit im Rahmen einer Heilbehandlung nach § 4 Nr. 14 Buchst. a Satz 1 UStG. Noch in 2019 schloss sich der BFH dieser EuGH-Rechtsprechung an.
Die Grundsätze des BFH-Urteils aus dem Jahr 2019 sind auf Umsätze in allen offenen Fällen anzuwenden. Für Umsätze, die bis zum 31.12.2023 erbracht werden, beanstandet es die Finanzverwaltung nicht, wenn der Unternehmer seine Leistungen abweichend von den oben genannten Ausführungen als umsatzsteuerpflichtig behandelt bzw. behandelt hat, sofern die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 14 Buchst. b Satz 2 Doppelbuchst. bb oder cc UStG nicht vorgelegen haben bzw. nicht vorliegen.
Hinweis: Die Grundsätze der Entscheidung des BFH aus dem Jahr 2017 sind, soweit die darin vertretene Rechtsauffassung durch das BFH-Urteil aus dem Jahr 2019 geändert wurde, nicht anzuwenden.
12. Sozialversicherungspflicht:
Pool-Arzt im vertragszahnärztlichen Notdienst ist abhängig beschäftigt
Ein Zahnarzt, der als sog. Pool-Arzt im Notdienst tätig ist, geht nicht deshalb automatisch einer selbständigen Tätigkeit nach, weil er mit dieser Tätigkeit an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnimmt. Dies geht aus einem neuen Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) hervor. Maßgebend sind nach Gerichtsmeinung vielmehr die konkreten Umstände des Einzelfalls. Das Urteil führte zu einem Prozesserfolg für den klagenden Zahnarzt, der seine Tätigkeit als versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eingestuft wissen wollte, damit die Kassenärztliche Vereinigung für ihn Sozialversicherungsbeiträge (nach-)zahlt.
Der Zahnarzt hatte seine Praxis im Jahr 2017 verkauft und war nicht mehr zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassen. In den Folgejahren übernahm er aber immer wieder Notdienste, die von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung organisiert worden waren. Die Vereinigung betrieb ein Notdienstzentrum, in dem sie personelle und sächliche Mittel zur Verfügung stellte. Der Zahnarzt rechnete seine Leistungen nicht individuell je Patient ab, sondern erhielt ein festes Stundenhonorar. Die Deutsche Rentenversicherung Bund sah den Kläger wegen seiner Teilnahme am vertragszahnärztlichen Notdienst als selbständig tätig an, so dass sie keine Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung annahm.
Das BSG ging jedoch von einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis aus und verwies auf die Eingliederung des Zahnarztes in die von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung organisierten Abläufe. Der Arzt hatte auf diese Abläufe keinen entscheidenden, erst recht keinen unternehmerischen Einfluss. Vielmehr hatte er eine von dritter Seite organisierte Struktur vorgefunden, in die er sich fremdbestimmt einfügte. Auch war er unabhängig von konkreten Behandlungen stundenweise bezahlt worden und verfügte nicht über eine Abrechnungsbefugnis, die für das Vertragszahnarztrecht eigentlich typisch ist. Dass der Arzt bei der konkreten medizinischen Behandlung frei und eigenverantwortlich handeln konnte, fiel für das BSG nicht entscheidend ins Gewicht. Im Ergebnis unterlag der Zahnarzt mit seiner
Notdiensttätigkeit daher der Versicherungspflicht.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
13. Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit:
Abgezweigte Zahlungen an Unterstützungskasse gehören zum Grundlohn
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, die ein Arbeitnehmer neben seinem Grundlohn für tatsächlich geleistete Arbeit zu diesen Zeiten erhält, können vom Arbeitgeber steuerfrei ausgezahlt werden, soweit sie bestimmte Prozentsätze des Grundlohns nicht übersteigen. Für Nachtarbeit in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr können beispielsweise Zuschläge bis zu 25 % des Grundlohns steuerfrei bleiben.
Hinweis: Der Grundlohn ist damit die zentrale Ausgangsgröße, von der sich die Höhe der steuerfrei zahlbaren Lohnzuschläge ableitet. Er ist in einen Stundenlohn umzurechnen und auf höchstens 50 € pro Stunde gedeckelt.
Im Interesse der Arbeitsparteien ist es also, möglichst viele Lohnbestandteile in den Grundlohn einzubeziehen. Einem Arbeitgeber aus Baden-Württemberg ist dies nun vor dem Bundesfinanzhof (BFH) gelungen. Er hatte vom Lohn seiner Arbeitnehmer aufgrund einer vereinbarten Gehaltsumwandlung monatlich Beiträge an eine Unterstützungskasse abgezweigt. Die Kasse war zugunsten der Arbeitnehmer errichtet worden, einen eigenen Leistungsanspruch hatten die Arbeitnehmer gegenüber der Kasse aber nicht. Das Finanzamt war nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung der Ansicht, dass die Beiträge an die Unterstützungskasse nicht zum Grundlohn gehörten. Für die Berechnung der steuerfreien Lohnzuschlagssätze sei nur das niedrigere, den Arbeitnehmern tatsächlich zugeflossene Arbeitsentgelt einzubeziehen. Das Amt kürzte daraufhin die steuerfrei gezahlten Lohnzuschläge und forderte Lohnsteuer vom Arbeitgeber nach.
Der BFH urteilte jedoch, dass auch die Beiträge an die Unterstützungskasse in den Grundlohn einzubeziehen sind und damit die Höhe der steuerfrei zahlbaren Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit beeinflussen. Nach
Gerichtsmeinung ist unerheblich, ob und in welchem Umfang der Grundlohn dem Arbeitnehmer tatsächlich zufließt. Maßgeblich ist vielmehr, welcher Arbeitslohn dem Arbeitnehmer – aufgrund der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum – arbeitsvertraglich zusteht.
Hinweis: Das Urteil ist eine gute Nachricht für Arbeitsparteien in Schichtarbeit, bei denen Lohnbestandteile aufgrund einer Gehaltsumwandlung nicht an den Arbeitnehmer ausgezahlt, sondern anderweitig verwendet werden. Maßgebende Ausgangsgröße für die Berechnung der steuerfreien Lohnzuschläge bleibt damit der arbeitsvertraglich
geschuldete Grundlohn.
14. Privater Nutzungsvorteil bei Dienstwagen:
Wechsel der Berechnungsmethode kann Steuern sparen
Immer zu Jahresbeginn können Arbeitnehmer mit Dienstwagen entscheiden, wie der geldwerte Vorteil für die private Nutzung berechnet werden soll – pauschal oder anhand der tatsächlichen Nutzung. Im Nachhinein können Sie die gewählte Berechnungsart auch noch in Ihrer Einkommensteuererklärung des betreffenden Jahres ändern. Dieser Schritt lohnt häufig, wenn man beispielsweise aufgrund von wenigen aufgezeichneten Privatfahrten steuerlich doch besser mit dem Fahrtenbuch als mit der Pauschalberechnung fährt. Wer von der pauschalen auf die tatsächliche Nutzung wechseln will, muss ein Fahrtenbuch mit lückenloser und ganzjähriger Dokumentation aller Fahrten führen.
Ein Dienstwagen, der auch privat genutzt werden darf, gilt steuerrechtlich als geldwerter Vorteil. Die Höhe des Vorteils darf pauschal nach der 1-%-Methode ermittelt werden, sofern der Wagen zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird. In diesem Fall müssen Arbeitnehmer jeden Monat pauschal 1 % des Neuwagen-Bruttolistenpreises lohnversteuern (0,25 % bei Elektroautos bis 60.000 €). Hinzu kommen 0,03 % für jeden Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder – falls die erste Tätigkeitsstätte nur gelegentlich aufgesucht wird – 0,002 % für jeden Entfernungskilometer multipliziert mit der Anzahl der Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte. Diese pauschale Vorteilsermittlung erfordert keine Einzelaufzeichnungen der tatsächlich unternommenen Fahrten.
Alternativ können Arbeitnehmer den geldwerten Vorteil anhand eines Fahrtenbuchs ermitteln. Das ist zumeist sinnvoll, wenn das Fahrzeug privat wenig gefahren wird, der Arbeitnehmer aber aus beruflichen Gründen sehr viel damit unterwegs ist. Im Fahrtenbuch müssen alle Fahrten notiert werden, sowohl die beruflichen als auch die privaten. Für die privaten Fahrten muss dann anteilig Einkommensteuer gezahlt werden.
Hinweis: Das Fahrtenbuch lohnt sich besonders, wenn die Gesamtkosten für den Dienstwagen gering ausfallen. Wenn beispielsweise das Auto bereits abgeschrieben wurde oder ein Gebrauchtwagen ist, sollte aus steuerlichen Gründen unterjährig unbedingt ein Fahrtenbuch geführt werden.
15. Wohnungswechsel für besseres Homeoffice:
Umzugskosten können absetzbar sein
Keine Lust mehr auf Homeoffice am Küchentisch? Viele Berufstätige mit kleinen Wohnungen haben während der Corona-Pandemie gemerkt, dass sie durch die Arbeit von zu Hause aus plötzlich einen erheblich höheren Platzbedarf haben. So auch ein Ehepaar aus Hamburg, das eine Wohnung von 65 qm bewohnte und während der
Corona-Pandemie (und danach) im Homeoffice arbeitete. Da sich die beengten Platzverhältnisse und die fehlenden Arbeitszimmer als problematisch erwiesen, zog das Ehepaar im Juli 2020 in eine rund 110 qm große Wohnung mit zwei Arbeitszimmern unweit der bisherigen Wohnung. Die Umzugskosten setzte das Ehepaar als Werbungskosten in seiner Einkommensteuererklärung an. Das Finanzamt lehnte ab und verwies auf den bislang geltenden Grundsatz, wonach Umzüge nur als beruflich bedingt anerkannt werden können, wenn sich die Arbeitswege deutlich – um mindestens eine Stunde – verkürzen.
Das Finanzgericht Hamburg (FG) gestand den Eheleuten nun jedoch den Werbungskostenabzug zu und verwies auf die neue mobile Arbeitswelt. Nach Meinung der Finanzrichter hat der Umzug zu einer wesentlichen Verbesserung und Erleichterung der Arbeitsbedingungen geführt und war damit beruflich veranlasst. Die Einrichtung von zwei Arbeitszimmern war erforderlich, um die jeweiligen Tätigkeiten ausüben zu können. Darin lag der Grund für den Umzug – auf einen erhöhten Wohnkomfort war es den Eheleuten hingegen nicht angekommen.
Hinweis: Gegen das Urteil ist eine Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängig, so dass zunächst die höchstrichterliche Klärung abzuwarten bleibt. Wer Umzugskosten in einem gleichgelagerten Fall getragen hat, sollte diese zunächst in seiner Einkommensteuererklärung als Werbungskosten abrechnen. Sollte das Finanzamt den Kostenabzug ablehnen, kann Einspruch eingelegt und unter Verweis auf den anhängigen BFH-Prozess ein Ruhen des Verfahrens erwirkt werden. So lässt sich später im eigenen Fall von einem positiven Richterspruch profitieren.
Kapitalanleger
16. Kapitalerträge:
Steuereinbehalt lässt sich mit NV-Bescheinigung vermeiden
Sparer können sich freuen, denn die lange Zeit von Null- und Negativzinsen ist endlich vorüber. Tagesgeld-, Festgeld- und Sparbriefanlagen werfen wieder Renditen ab. Wenn Kapitalanleger mit ihrem zu versteuernden Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegen (2023: 10.908 € für Ledige oder doppelt so viel bei Verheirateten), sollten sie prüfen, ob sie sich beim Finanzamt eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung (NV-Bescheinigung) ausstellen lassen können. Diese befreit vom Steuerabzug auf Kapitalerträge und führt dazu, dass bei Banken keine Freistellungsaufträge mehr gestellt werden müssen. Für den Kapitalanleger bringt dieser Schritt sofort 25 bis 28 % höhere Geldeingänge. Die Bescheinigung gilt für bis zu drei Jahre.
Die NV-Bescheinigung ist für alle interessant, die vergleichsweise hohe Kapitalerträge erwirtschaften und deren Gesamteinkommen gleichzeitig niedrig ausfällt. Sie kann daher insbesondere für Geringverdiener, Minijobber, Studierende und Rentner relevant sein. Auch für minderjährige Kinder kann sie sich als nützlich herausstellen, denn auch Geldanlagen der Kinder fallen ohne NV-Bescheinigung unter den Kapitalertragsteuereinbehalt.
Insbesondere „Bankenspringer“, die häufig Geschäfte mit wechselnden Banken machen, um stets den besten Zinssatz zu ergattern, können von der NV-Bescheinigung profitieren, denn sie müssen ihren Freistellungsauftrag nicht mehr jedes Mal neu zwischen den Banken aufteilen. Weiterhin unterbleibt der Steuereinbehalt dank NV-Bescheinigung auch für Kapitalerträge oberhalb des Sparerfreibetrags (1.000 € bei Ledigen oder 2.000 € bei Verheirateten). Die Kapitalerträge kommen also vollumfänglich „brutto für netto“ beim Anleger an.
Hinweis: Die NV-Bescheinigung wird beim Wohnsitzfinanzamt mit einem Vordruck beantragt, in dem alle Einkünfte vollständig angegeben werden müssen. Sie entbindet von der Abgabe einer Einkommensteuererklärung für die betreffenden Jahre. Jede Bank, Fondsgesellschaft oder Bausparkasse, bei der Gewinne erzielt werden, benötigt die NV-Bescheinigung im Original. Kopien, Scans oder digital versendete Fotos werden nicht anerkannt. Deswegen sollte bei der Antragstellung unbedingt angegeben werden, wie viele Bescheinigungen benötigt werden. Da die Bescheinigungen gebührenfrei erhältlich sind, ist es klüger, ein paar mehr anzufordern. Für die Ausstellung sollte eine Bearbeitungszeit von mindestens zwei Wochen eingeplant werden.
alle Steuerzahler
17. Ruhestandsbeamte:
Ehrenamtliche Gewerkschaftstätigkeit eröffnet Werbungskostenabzug
Rentnern und Pensionären steht alljährlich ein Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 € zu, der im Normalfall in
ihrem Steuerbescheid abgezogen wird, da zumeist keine höheren Werbungskosten angefallen sind. Zu den wenigen absetzbaren Kosten gehören bei Ruheständlern beispielsweise Kontoführungsgebühren (pauschal 16 €), Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften sowie Steuerberaterkosten, die anteilig auf die Erklärung des Ruhegehalts entfallen.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) dürfen Ruhestandsbeamte auch die Kosten für eine fortgeführte ehrenamtliche Gewerkschaftstätigkeit als Werbungskosten bei ihren Versorgungsbezügen absetzen. Geklagt hatte eine pensionierte Landesbeamtin, die schon während ihrer aktiven Dienstzeit hauptamtlich für eine Gewerkschaft tätig war. Ab dem Ruhestandseintritt arbeitete sie für verschiedene Gremien der Gewerkschaft. Die Kosten dafür rechnete sie als Werbungskosten ab.
Der BFH gab grünes Licht für den Kostenabzug und vertrat die Auffassung, dass die Aufwendungen in einem hinreichenden Veranlassungszusammenhang mit ihren Versorgungsbezügen standen, da die Gewerkschaftsarbeit auf die Verbesserung ihrer Einkünfte als Ruhestandsbeamtin abzielte. Gewerkschaften sind solidarische Interessenvertretungen, deren Zweck auf die Verbesserung der beruflichen Bedingungen ihrer Mitglieder gerichtet ist. Der BFH verwies auf seine bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung, die bei Kosten der Gewerkschaftsarbeit eines noch berufstätigen Steuerzahlers einen objektiven Zusammenhang mit seiner Berufstätigkeit bejaht. Diese Grundsätze können nach Ansicht der Bundesrichter auch auf ehrenamtliche Gewerkschaftler im Ruhestand übertragen werden, denn Gewerkschaften vertreten nicht nur die beruflichen Interessen von berufstätigen Arbeitnehmern und Beamten, sondern auch die Interessen von Pensionären.
18. Außergewöhnliche Belastungen:
Kosten für Pflegewohngemeinschaft sind abziehbar
Kosten für die eigene Pflege sind im Regelfall als allgemeine außergewöhnliche Belastungen abziehbar, da diese Kosten zwangsläufig entstehen und andere vergleichbare Steuerzahler sie nicht zu tragen haben. Insbesondere die krankheitsbedingte Unterbringung in einem Alten- oder Pflegeheim kann als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden. Erhaltene Leistungen (z. B. aus der Pflegeversicherung) müssen aber gegengerechnet werden.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, dass auch die Kosten für eine Pflegewohngemeinschaft absetzbar sind, in der Senioren selbstverantwortet leben. Im verhandelten Fall war ein schwerbehinderter und pflegebedürftiger Senior (Grad der Behinderung 100, Pflegegrad 4) gemeinsam mit anderen pflegebedürftigen Menschen in einer Pflegewohngemeinschaft untergebracht, die dem Wohn- und Teilhabegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen unterfiel. Dort wurde er rund um die Uhr von einem ambulanten Pflegedienst und Ergänzungskräften betreut, gepflegt und hauswirtschaftlich versorgt.
Die Kosten für Kost und Logis machte er als außergewöhnliche Belastungen in seiner Einkommensteuererklärung geltend. Das Finanzamt setzte hier jedoch den Rotstift an, da die Aufwendungen nach dessen Ansicht nur bei einer vollstationären Heimunterbringung abzugsfähig wären.
Der BFH erkannte die Kosten jedoch als außergewöhnliche Belastung an und stellte klar, dass Aufwendungen für die krankheits- oder pflegebedingte Unterbringung in einer dafür vorgesehenen Einrichtung grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig sind. Dies gilt nicht nur für die Unterbringung in einem Heim, sondern auch für die Unterbringung in einer Pflegewohngemeinschaft, die dem jeweiligen Landesrecht unterfällt. Ausschlaggebend ist allein, dass die Pflegewohngemeinschaft – ebenso wie das Heim – vor allem dem Zweck dient, ältere oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung aufzunehmen und ihnen Wohnraum zu überlassen, in welchem die notwendigen Betreuungs-, Pflege- und Versorgungsleistungen erbracht werden.
Die steuerliche Abzugsfähigkeit der Unterbringungskosten setzt nach Gerichtsmeinung nicht voraus, dass dem Steuerzahler – wie bei der vollstationären Heimunterbringung – Wohnraum und Betreuungsleistungen „aus einer Hand“ zur Verfügung gestellt werden. Es genügt vielmehr, wenn die gepflegte Person in der Pflegewohngemeinschaft gemeinschaftlich organisierte Betreuungs-, Pflege- und Versorgungsleistungen von einem oder mehreren externen (ambulanten) Leistungsanbietern bezieht.
Hinweis: Krankheits- oder pflegebedingt anfallende Kosten sind allerdings nur insoweit abzugsfähig, wie sie zusätzlich zu den Kosten der normalen Lebensführung anfallen. Deshalb waren die Unterbringungskosten im Urteilsfall noch um eine sogenannte Haushaltsersparnis des Seniors zu kürzen. Deren Höhe bestimmte der BFH im Wege der Schätzung nach dem steuerlich abziehbaren Höchstbetrag, der für den Unterhalt unterhaltsbedürftiger Personen gilt – im Streitjahr lag dieser bei 8.652 €.
19. Männliches Paar mit Kinderwunsch:
Kosten für Ersatzmutter sind nicht absetzbar
Erfüllen sich zwei miteinander verheiratete Männer ihren Kinderwunsch über eine Ersatzmutterschaft, so lassen sich die hierbei entstehenden Kosten nicht als außergewöhnliche Belastungen absetzen. Dies geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatten zwei Männer, die eine Ersatzmutter in den USA engagiert hatten. Die Frau hatte sich eine Eizelle einer anderen US-Amerikanerin einpflanzen lassen. Die Zelle war zuvor mit Samenzellen eines der Männer künstlich befruchtet worden. Nachdem das Kind geboren war, nahm das deutsche Männerpaar es mit nach Deutschland.
Das Finanzamt erkannte die Kosten für die Ersatzmutterschaft nicht als außergewöhnliche Belastung an und wurde darin nun vom BFH bestätigt. Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass keine abzugsfähigen Krankheitskosten vorlagen, da eine Krankheit ein anormaler regelwidriger Körperzustand sei. Die Kinderlosigkeit der Männer gründete jedoch gerade nicht auf einem regelwidrigen Zustand, sondern auf den biologischen Grenzen der Fortpflanzung. Die Männer
konnten auch nicht mit Erfolg darauf verweisen, dass der unerfüllte Kinderwunsch bei einem der Partner eine beginnende psychische Erkrankung ausgelöst hatte und diese durch die Ersatzmutterschaft geheilt werden konnte.
Der BFH betonte, dass ein von einer Ersatzmutter geborenes Kind keine medizinisch indizierte Heilbehandlung einer seelischen Erkrankung sein kann. Eine solche Einordnung ist nicht mit dem Grundrecht des Kindes auf Unantastbarkeit seiner Menschenwürde vereinbar. Würde man das Kind derart einordnen, würde es zu einem bloßen Objekt herabgewürdigt, das zur Linderung einer seelischen Krankheit dient. Zudem würde auch die Ersatzmutter auf ein medizinisches Hilfsmittel reduziert.
Hinweis: Zusätzlich verwies der BFH darauf, dass ein Abzug als außergewöhnliche Belastung auch daran scheiterte, dass die (Heil-)Maßnahme nicht mit der innerstaatlichen Rechtsordnung in Einklang steht. Die Ersatzmutterschaft ist nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz hierzulande nicht zulässig.
20. Für Rentner und Pensionäre:
Vier Bundesländer akzeptieren vereinfachte Einkommensteuererklärung
Viele steuerlich relevante Informationen liegen dem Finanzamt bereits vor, bevor der Steuerbürger überhaupt seine
Einkommensteuererklärung abgibt. Der Grund liegt darin, dass in den letzten Jahren die elektronischen Meldepflichten gegenüber den Finanzämtern immer weiter ausgebaut wurden, so dass viele Informationen elektronisch an die Finanzbehörden übermittelt werden. Das gilt beispielsweise für die Lohnsteuerbescheinigungen (sowohl für aktive
Arbeitnehmer als auch für Pensionäre mit Versorgungsbezügen) und die Rentenbezugsmitteilungen, so dass den Finanzämtern auch die Einkünfte von Rentnern und Pensionären in der Regel lückenlos bekannt sind.
In den Bundesländern Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen können Rentner und Pensionäre bereits seit 2018 eine vereinfachte Einkommensteuererklärung abgeben – eine sogenannte „Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften”.
Hinweis: Auf dem zweiseitigen Papiervordruck müssen Rentner und Pensionäre lediglich allgemeine Angaben zu ihrer Person und zu steuermindernden Kosten (Vorsorgeaufwendungen, Spenden und Mitgliedsbeiträge, Kirchensteuer, außergewöhnliche Belastungen, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen) machen. Die übrigen Daten zu Renten, Pensionen sowie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen werden von den Finanzämtern automatisch berücksichtigt.
Das Bundesministerium der Finanzen hat nun den vereinfachten Erklärungsvordruck für den Veranlagungszeitraum 2022 veröffentlicht. Der Bogen ist jetzt auch am PC ausfüllbar und kann anschließend als Papierausdruck unterschrieben an das Finanzamt übersandt werden.
Hinweis: Die vereinfachte Erklärung kommt nur für Rentner und Pensionäre in Betracht, die keine Nebeneinkünfte (wie beispielsweise Einkünfte aus Vermietung oder Gewerbebetrieb) erzielt haben.
21. Ukraine-Krieg:
Erleichterungen für Spendenabzug gelten auch 2024
Spenden an notleidende Menschen aus der Ukraine können von Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen steuerlich unter erleichterten Voraussetzungen abgesetzt werden. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte hierfür
Anfang 2022 entsprechende Regelungen erlassen, die ursprünglich nur bis zum 31.12.2022 galten. Nach einer ersten Verlängerung bis zum Jahresende 2023 hat das BMF nun erklärt, dass die Erleichterungen auch für das Jahr 2024 anwendbar sind. Es gelten somit unter anderem folgende Regelungen fort:
- Geldspenden: Wer Geld an notleidende Menschen aus der Ukraine spendet, benötigt für die Einkommensteuererklärung lediglich einen vereinfachten Zuwendungsnachweis – und zwar ohne Beschränkung des Betrags. Das heißt: Selbst wer 5.000 € spendet, muss lediglich einen Kontoauszug, einen Lastschriftbeleg oder einen Ausdruck aus dem Onlinebanking aufbewahren. Die Spende muss jedoch auf ein Sonderkonto einer inländischen steuerbegünstigten Körperschaft eingezahlt werden, die für diesen besonderen Zweck (Ukraine-Krise) extra eingerichtet wurde.
- Spendenaktionen: Steuerbegünstigte Körperschaften wie Sportvereine oder Musikvereine dürfen finanzielle Mittel für steuerbegünstigte Zwecke eigentlich nur verwenden, wenn sie diese Zwecke laut ihrer Satzung fördern. Wollen sie aber von der Ukraine-Krise Betroffene finanziell unterstützen, dürfen sie ausnahmsweise im Rahmen einer Sonderaktion zu Spenden aufrufen und diese dann unmittelbar einsetzen, ohne ihre Satzung entsprechend ändern zu müssen. Sie haben allerdings die Bedürftigkeit der unterstützten Personen oder Einrichtungen selbst zu prüfen und dies zu dokumentieren.
- Hilfsaktionen: Steuerbegünstigte Körperschaften dürfen ausnahmsweise auch vorhandene Mittel, die nicht anderweitig gebunden sind, ohne Satzungsänderung für die Unterstützung von Betroffenen einsetzen. Das gilt auch für die Überlassung von Personal und Räumlichkeiten.
- Arbeitslohnspende: Verzichten Arbeitnehmer auf Teile ihres Lohns zugunsten einer Zahlung des Arbeitsgebers auf ein Spendenkonto einer steuerbegünstigten Körperschaft oder zugunsten eines vom Ukraine-Krieg geschädigten Beschäftigten des Unternehmens, werden diese Lohnteile steuerfrei gestellt.
- Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen: Wenn Unternehmer vom Krieg in der Ukraine geschädigte Personen unterstützen, können ihre Aufwendungen nach sogenannten Sponsoring-Regelungen zum Betriebsausgabenabzug zugelassen werden. Hiernach ist ein Betriebsausgabenabzug erlaubt, wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile für sein Unternehmen erstrebt, die in der Sicherung oder Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens liegen können.
22. Aktuelle Steuerschätzung:
Bundesfinanzminister sieht keine neuen Verteilungsspielräume
Im Oktober 2023 hat die 165. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen stattgefunden, eines unabhängigen Beirats des Bundesministeriums der Finanzen, der zweimal im Jahr zusammentritt. Das Expertengremium kam zu dem Ergebnis, dass die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen im Jahr 2023 niedriger ausfallen werden, als noch in der vergangenen Schätzung vom Mai 2023 erwartet. Die geschätzten Steuereinnahmen des Bundes fallen für 2023 um 3,6 Mrd. € geringer aus. Als Ursache wird auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung verwiesen.
Der Bundesfinanzminister erklärte, dass sich aus dem Schätzergebnis keine neuen Verteilungsspielräume ableiten
ließen. Ab 2024 soll die Einnahmesituation jedoch tendenziell wieder leicht besser ausfallen, als noch im Mai 2023
prognostiziert.
Die prognostizierten Steuereinnahmen des Bundes liegen im Jahr 2023 bei 356,3 Mrd. € und steigen bis zum Jahr 2028 auf jährlich 437,2 Mrd. € an. Auch bei den Ländern wird mit einem kontinuierlichen Einnahmezuwachs von 383,4 Mrd. € im Jahr 2023 bis 465,50 Mrd. € im Jahr 2028 gerechnet. Bei den Gemeinden ergibt sich ein erwarteter Zuwachs von 139,3 Mrd. € 2023 auf 172,3 Mrd. € 2028.
Hinweis: Aufgrund der in die Schätzung einbezogenen Steuerrechtsänderungen – dem KiTa-Qualitätsgesetz und dem Pauschalentlastungsgesetz – kommt es zu Umverteilungen vom Bund zugunsten der Länder. Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf für das Wachstumschancengesetz ist hingegen noch nicht in der Schätzung enthalten.
23. Kurzfristiger Flugausfall:
Aufhebung des Verhandlungstermins muss besonders begründet werden
Verfahrensbeteiligte haben vor Gericht einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Ihnen muss die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den entscheidungserheblichen Tatsachen und Beweisergebnissen zu äußern und ihre Rechtsansichten vorzutragen. Der mündlichen Verhandlung kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Ein Gericht muss den anberaumten Verhandlungstermin daher aufheben oder verlegen, wenn erhebliche Gründe (z.B. eine akute Erkrankung eines Beteiligten) vorliegen.
Kann ein Prozessbeteiligter aufgrund des kurzfristigen Ausfalls einer Flugverbindung nicht zur mündlichen Verhandlung anreisen, muss der Termin aber nur dann aufgehoben werden, wenn der Antrag besonders begründet wurde. Dies geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor. Die Bundesrichter halten es für geboten, dass die verhinderte Prozesspartei in diesem Fall im Aufhebungsantrag zumindest darlegt, warum kein alternatives Verkehrsmittel genutzt werden konnte.
Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Prozessbevollmächtigter am Vorabend der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, dass sein für den nächsten Morgen gebuchter Flug von Düsseldorf nach München (zum Verhandlungstermin) annulliert worden sei. Eine Zuschaltung per Videotelefonie lehnte er ab.
Der BFH entschied, dass die mündliche Verhandlung in diesem Fall nicht aufzuheben war und ohne den Prozessbevollmächtigten stattfinden durfte, da dieser nicht dargelegt hatte, warum er am Vorabend nicht per Bahn oder mit dem Auto anreisen konnte. Ebenfalls blieb offen, warum es keine späteren Alternativflüge gab. Weiter verwies der BFH darauf, dass der Klägerseite auch eine spontane Zuschaltung zum Termin per Videoübertragung möglich gewesen sei.
Hinweis: Die Entscheidung zeigt, dass Anreiseprobleme vor Gericht besonders begründet werden müssen. Im Jahr 1985 hatte das Bundesverwaltungsgericht noch entschieden, dass sich eine Prozesspartei darauf verlassen darf, dass Beförderungszeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln eingehalten werden. Der BFH erklärte nun, dass sich dieser Grundsatz kaum auf die heutige Zeit übertragen lässt, da Zug- und Flugausfälle heutzutage praktisch an der Tagesordnung sind. Bei der Anreise zur mündlichen Verhandlung sollten die Prozessparteien daher zeitliche Puffer einplanen.
24. Gerichtsverhandlung per Videokonferenz:
Prozessbeteiligte müssen sich direkt sehen können
Niemand hat gerne sein Finanzamt im Nacken – auch nicht wortwörtlich als Videoprojektion hinter sich im Gerichtssaal. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass eine Videoverhandlung mit solch einem technischen Aufbau einen Verfahrensfehler begründet.
Vorliegend ging es um den Fall eines Geschäftsführers, der sein Finanzamt vor dem Finanzgericht Münster (FG) auf Akteneinsicht verklagt hatte. Die mündliche Verhandlung hatte im Rahmen einer Videokonferenz stattgefunden. Der
Geschäftsführer war zwar im Gerichtssaal anwesend, das beklagte Finanzamt jedoch nur per Video zugeschaltet. Das Bild der Finanzamtsvertreter war an die Wand hinter dem Geschäftsführer projiziert worden, so dass dieser seine Prozessgegner nur sehen konnte, wenn er sich um 180 Grad drehte.
Der BFH hob das finanzgerichtliche (abweisende) Urteil nun aufgrund eines Verfahrensmangels auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung zurück an das FG. Der Anspruch des Klägers auf rechtliches Gehör war durch den technischen Aufbau verletzt, da bei einer Videoverhandlung jeder Beteiligte zeitgleich die Richterbank und die anderen Beteiligten visuell und akustisch wahrnehmen können muss. Daran fehlt es, wenn ein Beteiligter seinen per Video zugeschalteten Prozessgegner nur sehen kann, wenn er sich um 180 Grad dreht. Es sei möglich, dass sich der Geschäftsführer nicht auf den Prozess konzentrieren konnte, da er wiederholt hin- und herschauen musste.
Der BFH erklärte, dass die Videoübertragungstechnik ohne Verlust rechtsstaatlicher Qualität genutzt werden muss. Durch den vom FG gewählten technischen Aufbau war nicht ausgeschlossen, dass dem klagenden Geschäftsführer diverse Einzelheiten entgingen – beispielsweise die Mimik und Gestik der Finanzamtsvertreter oder der Richter. Zwar sitzen Prozessbeteiligte auch bei einer Präsenzverhandlung im Regelfall lediglich nebeneinander vor der Richterbank und sich nicht gegenüber – sie können sich dann aber zumindest aus dem Augenwinkel wahrnehmen. Ob das FG nun im zweiten Rechtsgang erneut per Videoschaltung oder aber in Präsenz verhandeln wird, blieb offen.
Hinweis: Bereits kurz zuvor hatte der BFH in einem anderen Fall entschieden, dass während einer Videoverhandlung alle zur Entscheidung berufenen Richter für die zugeschalteten Beteiligten sichtbar sein müssen. Im zugrunde liegenden Fall war während der überwiegenden Zeit nur der Vorsitzende Richter des Senats im Bild zu sehen gewesen. Der BFH verwies darauf, dass für die Prozessbeteiligten auch während einer Videokonferenz feststellbar sein muss, ob die beteiligten Richter in der Lage sind, der Verhandlung in ihren wesentlichen Abschnitten zu folgen. Tatsächlich muss feststellbar sein, ob ein Richter eingeschlafen ist, erst verspätet auf der Richterbank Platz genommen hat oder vorzeitig gegangen ist.
25. Kapitalerträge:
Ist der Nutzungsersatz bei Darlehenswiderruf steuerpflichtig?
In den zurückliegenden Jahren gab es einige Fälle, in denen Steuerpflichtige ihre Darlehensverträge aufgrund einer fehlenden Widerrufsbelehrung widerriefen. Dies führte zu einer Rückabwicklung des Darlehensvertrags. Die Bank
erhielt dann den Darlehensbetrag zurück und der Darlehensnehmer die bisher gezahlten Zinsen und Tilgungen. Da die Bank in der bisherigen Laufzeit des Darlehens mit den Tilgungsraten wirtschaften konnte, wird in der Regel ein
Nutzungsersatz zwischen den Parteien vereinbart. Das Finanzgericht Hessen (FG) musste entscheiden, wie dieser Nutzungsersatz steuerlich zu behandeln ist.
Die Klägerin hatte mit ihrer Bank im Jahr 2006 einen Darlehensvertrag geschlossen. Nach erfolgtem Widerruf verglichen sich die Parteien in 2017 auf die Rückzahlung einer „Vorfälligkeitsentschädigung“ und auf die Zahlung eines „Nutzungsersatzes“ an die Klägerin. Alle sonstigen Ansprüche aus dem Darlehen sollten durch den Vergleich abgegolten sein. Die Bank erteilte eine Steuerbescheinigung mit dem Nutzungsersatz als Kapitalertrag. Im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung beantragte die Klägerin die Berücksichtigung der von der Bank bescheinigten Kapitalertragsteuer. Zwar kam das Finanzamt dem nach, berücksichtigte jedoch auch Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Die hiergegen gerichtete Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehört auch der Nutzungsersatzanspruch eines Darlehensnehmers, wenn das Darlehen rückabgewickelt wird und die Bank als Ersatz für Nutzungsvorteile nach dem Widerruf einen Vergleichsbetrag zahlt. Wie der Rückzahlungsbetrag aufgeteilt wird, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Die von der Klägerin geforderte Aufteilung des im Vergleich bezeichneten Nutzungsersatzes auf mehrere Positionen kommt deshalb nicht in Betracht, weil der eindeutige Wortlaut und die Systematik des getroffenen Vergleichs dem entgegenstehen. Nutzungsersatz und Nutzungsherausgabe bilden keine wirtschaftliche Einheit. Die Klägerin hat auch nicht überzeugend dargelegt, dass keine Einkünfteerzielungsabsicht vorliegt. Entgegen ihrer Ansicht handelt es sich beim Nutzungsersatz nicht um die Rückgewähr von Aufwendungen der privaten Lebensführung.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Sollte bei Ihnen ein ähnlicher Fall vorliegen, sprechen Sie uns gerne an.
26. Versicherungsleistung:
Wie wird eine befristete Berufsunfähigkeitsrente besteuert?
Auch wenn es gut ist, sich gegen gewisse Ereignisse abzusichern, ist man doch meistens froh, eine Versicherung nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Das trifft beispielsweise auf die Berufsunfähigkeitsversicherung zu. Eine Berufsunfähigkeitsrente bekommt man in der Regel, wenn man seinen Beruf für lange Zeit nicht mehr ausüben kann. Die Rente wird so lange gezahlt, bis der Versicherte wieder berufsfähig ist, höchstens jedoch bis zum Ende der Vertragslaufzeit. Wie wird eine solche Rente eigentlich besteuert? Und macht es einen Unterschied, wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Altersvorsorge kombiniert ist? Darüber hatte das Finanzgericht Niedersachsen (FG) zu entscheiden.
Die Kläger sind verheiratet und werden zusammen veranlagt. 2017 teilte die X-Lebensversicherung der Klägerin mit, dass sie wegen Berufsunfähigkeit Anspruch auf Leistungen habe. Im selben Jahr erhielt sie rückwirkend zum 01.05.2014 die monatlichen Zahlungen in einem Betrag ausbezahlt. Auch in den Jahren 2018 und 2019 erfolgten Zahlungen. Im
Vertrag waren als Hauptleistung die Zahlung einer jährlichen Rente bei Rentenbeginn zum 01.06.2035 und eine Zusatzvereinbarung hinsichtlich einer Beitragsfreiheit bei Berufsunfähigkeit und eine Rente bis zum 01.06.2025 vorgesehen. Die Versicherungsgesellschaft gab in der Rentenbezugsmitteilung eine Leibrente an. Das Finanzamt folgte den Angaben nicht und unterwarf den steuerpflichtigen Teil der Nachzahlung der ermäßigten Besteuerung. Nach Ansicht der Kläger ist das Finanzamt jedoch zur Übernahme der übermittelten Daten verpflichtet. Dadurch ergebe sich eine Versteuerung mit dem Besteuerungsanteil und nicht mit dem Ertragsanteil.
Die Klage vor dem FG war begründet. Die ausgezahlten Versicherungsleistungen wurden zu Unrecht mit dem Ertragsanteil besteuert. Die Zusatzversicherung der Berufsunfähigkeitsrente ist grundsätzlich eine unschädliche ergänzende
Absicherung. Die Beitragsanteile der Versicherung entfallen zu ca. 50 % auf die Berufsunfähigkeitsversicherung, so dass eigentlich nicht mehr von einer „ergänzenden“ Absicherung die Rede sein kann. Nach Ansicht des Gerichts ist eine
„ergänzende“ Absicherung nur anzunehmen, wenn die Zahlungen aus der Berufsunfähigkeitsrente erst mit Beginn der Altersrente enden.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.
27. Kindergeld und Kinderbonus:
Wann der Anspruch für ein Pflegekind beginnt
Haben Sie minderjährige Kinder? Dann bekommen Sie Kindergeld. Unter bestimmten Umständen gibt es Kindergeld auch noch für ein Kind über 18 Jahre. Zudem kann man Kindergeld nicht nur für leibliche Kinder erhalten, sondern auch für Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder. Aber wann genau beginnt der Kindergeldanspruch für ein Pflegekind? Darüber musst das Finanzgericht Sachsen-Anhalt (FG) in einem Streitfall entscheiden.
Das Pflegekind B wurde am 26.11.2020 geboren. Am 20.01.2021 beantragte der Kläger Kindergeld für B. Er gab an, dass B sich seit dem 07.12.2020 auf unbestimmte Zeit in seinem Haushalt aufhalte und er das Kind ganztägig und durchgehend an allen Wochentagen versorge. Die leiblichen Eltern würden B nicht besuchen. Die Familienkasse lehnte mit Bescheid vom 08.02.2021 die Kindergeldfestsetzung für November und Dezember 2020 ab, da das Kind erst am 07.12.2020 in den Haushalt aufgenommen worden sei, so dass sich erst ab Januar 2021 ein Anspruch ergebe. Kindergeld für den gesamten Monat erhalte der Elternteil, der zu Beginn des Monats Anspruch darauf gehabt habe. Daher habe der Kläger in den fraglichen Monaten keinen Anspruch auf Kindergeld gehabt.
Die Klage vor dem FG war teilweise begründet. Der Kläger hat Anspruch auf Kindergeld für Dezember 2020 sowie auf den Kinderbonus 2020. Für November 2020 besteht jedoch kein Anspruch auf Kindergeld. Auch ohne Adoptionsabsicht könne eine enge Eltern-Kind-Beziehung bestehen, wenn die Pflegeeltern das Kind wie ein eigenes betreuten. Wem das Sorgerecht zustehe, sei unerheblich. Ab dem 07.12.2020 habe ein familienähnliches Band bestanden, denn das Kind habe sich im Haushalt des Klägers aufgehalten und sei zu dessen Familie angehörig angesehen und behandelt worden. Bereits mit Schreiben des Jugendamts vom 27.11.2020 habe festgestanden, dass das Pflegekindschaftsverhältnis auf Dauer angelegt sei. Zwar sei die Aufnahme während eines laufenden Monats erfolgt, aber für Dezember 2020 sei für keinen Berechtigten Kindergeld festgesetzt worden, so dass es auch keine Doppelzahlung gegeben habe. Und da der Kläger für Dezember 2020 Anspruch auf Kindergeld habe, habe er letztlich auch Anspruch auf den Kinderbonus 2020.
28. Fragliche Steuerpflicht:
Sparer-Pauschbetrag bei beschränkter Steuerpflicht?
Auch wenn jemand nicht mehr in Deutschland wohnt oder sich hierzulande aufhält, kann er in Deutschland steuerpflichtig sein – allerdings nur beschränkt steuerpflichtig. Beispielsweise muss man für ein Vermietungsobjekt in Deutschland Steuern zahlen, obwohl man im Ausland lebt. Aber auch für Kapitaleinkünfte können Steuern anfallen. Das Finanzgericht Saarland (FG) musste entscheiden, ob dann auch ein Sparer-Freibetrag zu berücksichtigen ist.
Der Kläger lebte 2017 in den Vereinigten Arabischen Emiraten und war in Deutschland mit Vermietungseinkünften beschränkt steuerpflichtig. Darüber hinaus erzielte er Kapitalerträge, für die das deutsche Kreditinstitut Steuern einbehielt. In seiner Einkommensteuererklärung beantragte der Kläger die Günstigerprüfung für seine Kapitaleinkünfte. Das Finanzamt berücksichtigte nur die Vermietungseinkünfte und setzte die Einkommensteuer auf 0 € fest. Der Kläger legte daraufhin Einspruch ein, da kein Sparer-Pauschbetrag berücksichtigt wurde. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen dürften beide Länder die Dividende besteuern. Eine mögliche Doppelbesteuerung werde durch Anwendung der Anrechnungsmethode in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgemildert.
Die Klage vor dem FG war trotz des Nullbescheids (Steuerfestsetzung von 0 €) zulässig, aber unbegründet. Beschränkt Steuerpflichtige haben keinen Anspruch auf den Sparer-Freibetrag, wenn keine Veranlagung der Kapitalerträge erfolgt. Die Einkommensteuer ist durch den Steuerabzug abgegolten (Abgeltungsteuer). Auch wenn der Kläger schlechter gestellt werde als ein unbeschränkt Steuerpflichtiger, sei dies kein Verstoß gegen höherrangiges Recht. Eine Steuerveranlagung sei bei in Drittstaaten Ansässigen nicht geboten. Es könne im Streitfall offenbleiben, ob bei den Einkünften aus Kapitalvermögen Unterschiede in der Behandlung beschränkt Steuerpflichtiger gegenüber unbeschränkt Steuerpflichtigen bestünden. Da die Besteuerungssachverhalte von beschränkt und unbeschränkt Steuerpflichtigen nicht vergleichbar seien, liege auch kein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot vor.
Hinweis: Sie wollen Deutschland für einige Zeit oder für immer verlassen? Wir erläutern Ihnen die steuerlichen Konsequenzen.
29. Steuerfreie Zuwendung an eine Stiftung:
Fragliche Erbschaftsteueraufhebung
Wenn man etwas erbt, fällt Erbschaftsteuer an. Jedoch kann diese in manchen Fällen rückwirkend aufgehoben
werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das kann etwa der Fall sein, wenn ein Geschenk wieder zurückgegeben werden muss. Oder auch, wenn Vermögensgegenstände innerhalb von 24 Monaten nach dem Erbfall zum Beispiel an den Bund oder eine inländische gemeinnützige Stiftung übertragen werden. Das Finanzgericht München (FG) musste in einem Streitfall darüber entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Erbschaftsteuer
vorlagen.
Die Klägerin war eine inländische gemeinnützige Stiftung. Sie wurde aufgrund notariellen Erbvertrags Alleinerbin der am 21.11.2017 verstorbenen X. X wiederum war Alleinerbin ihres am 09.03.2016 verstorbenen Ehemannes Y. Aufgrund der Erbschaftsteuererklärung von X setzte das Finanzamt gegen sie am 23.08.2017 Erbschaftsteuer in Höhe von 468.635 € fest. Der Bescheid wurde zum 27.03.2019 geändert und darin Erbschaftsteuer in Höhe von 458.090 € gegen die Klägerin festgesetzt. Gegen keinen der Bescheide wurde Einspruch eingelegt. Am 02.11.2020 beantragte die Klägerin, den Bescheid vom 27.03.2019 aufzuheben, da die Voraussetzungen für das Erlöschen der Erbschaftsteuer erfüllt seien. Dies wurde vom Finanzamt mit Bescheid vom 25.11.2020 abgelehnt.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Nach dem Gesetz erlischt die Steuer rückwirkend, wenn die erworbenen Vermögensgegenstände innerhalb von 24 Monaten einer inländischen gemeinnützigen Stiftung zugewendet werden. Dies traf im Streitfall zu. Allerdings war im Streitfall bereits ein Bescheid ergangen. Zur Aufhebung dieses Bescheids muss ein rückwirkendes Ereignis eingetreten sein. Das Ereignis muss also nachträglich, das heißt erst nach dem Steueranspruch, entstanden sein. Demzufolge konnte der Bescheid vom 27.03.2019 nicht mehr geändert werden. Das Ereignis „Erwerb des Nachlasses des Y durch die Stiftung“ war nicht erst nach Ergehen des Bescheids vom 27.03.2019 eingetreten, sondern bereits mit dem Tod der X am 21.11.2017. Eine Änderung war also aufgrund der Bestandskraft des Bescheids nicht mehr möglich. Es hätte rechtzeitig Einspruch gegen den Bescheid eingelegt werden müssen.
30. Steuerformulare:
Kann ein Bescheid nach Bekanntwerden eines Fehlers geändert werden?
Das deutsche Steuerrecht ist wahrlich nicht einfach. Es gibt viele Regelungen, Ausnahmen und auch Abzugsmöglichkeiten. Damit das Steuerrecht richtig angewendet werden kann, müssen die entsprechenden Formulare ausgefüllt werden. Auch das ist nicht ganz einfach. So kann es vorkommen, dass aus Versehen falsche Werte oder auch doppelte
Werte eingetragen werden. Im Urteilsfall musste das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) entscheiden, ob eine versehentliche doppelte Eintragung später geändert werden kann.
Der Kläger erhielt im Streitjahr eine Dividende von seiner Betriebs-GmbH. Diese war den Einkünften aus Gewerbebetrieb zuzurechnen. Steuern wurden bereits von der GmbH einbehalten. In den eingereichten Steuererklärungen des Klägers wurde der Gewinn aus Gewerbebetrieb, der auch die Dividende enthielt, in Anlage G erklärt. Des Weiteren wurde die Dividende auch in Anlage KAP eingetragen. Die Veranlagung durch das Finanzamt erfolgte erklärungsgemäß. Der Bescheid wurde im Anschluss formell bestandskräftig. Vor Ablauf der Festsetzungsverjährungsfrist beantragte der Klägerbevollmächtigte eine Änderung des Bescheids, da ihm auffiel, dass die Dividende zweimal der Steuer unterworfen worden war. Das Finanzamt lehnte diesen Antrag ab.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich, der Bescheid kann geändert werden. Die später erkannte doppelte Erfassung der Dividende sei eine nachträglich bekanntgewordene Tatsache. Nach Auskunft des Finanzamts habe dieses nicht gewusst, dass es sich bei den beiden Einträgen um die gleiche Dividende gehandelt habe. Nach Ansicht des FG traf weder das Finanzamt noch den Kläger ein grobes Verschulden daran, dass die Doppelerfassung erst nachträglich bekanntwurde. Es sei auch kein Vorsatz erkennbar. Ein persönliches Verschulden des Klägers bei der Zuarbeit zur Steuererklärung oder der Auswahl und Überwachung des Klägerbevollmächtigten bei Erstellung der Steuererklärungen sei ebenfalls nicht ersichtlich. Auch ein grobes Verschulden des Bevollmächtigten liege nicht vor.
31. Bescheidänderung:
Risikomanagement beim Finanzamt
Kennen Sie das Risikomanagementsystem des Finanzamts? Diese Software soll dem Finanzamt schnell anzeigen, ob in einer Steuererklärung auffällige Sachverhalte enthalten sind. Umgekehrt können damit auch die unauffälligen Routinefälle sofort erkannt und schnell abgeschlossen werden. Aber was ist, wenn ein auffälliger Sachverhalt durch das System nicht erkannt wird? Kann das Finanzamt sich dann bei einer späteren Bescheidänderung darauf berufen, dass kein entsprechender Hinweis kam? Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) musste in einem Fall entscheiden, ob der Bescheid dann noch geändert werden kann.
Die Kläger sind Ehegatten und wurden 2016 zusammen veranlagt. Die Klägerin betrieb eine Praxis. Die Räume hierfür wurden ihr vom Kläger umsatzsteuerpflichtig vermietet. Nach einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung erstattete das Finanzamt dem Kläger im Jahr 2016 die aus der Herstellung der Praxisräume resultierenden Vorsteuerbeträge in Höhe von 23.023 €. Nach einem Einspruch des Klägers erhielt dieser eine weitere Vorsteuererstattung in Höhe von 163 €.
In der Einkommensteuererklärung erfasste die vom Kläger beauftragte Steuerberaterkanzlei versehentlich nur die
erstatteten 163 €. Diese Unrichtigkeit übernahm das Finanzamt bei der Veranlagung. Als ihm das Fehlen der 23.023 € in einer späteren Außenprüfung auffiel, änderte es den Bescheid entsprechend.
Die hiergegen gerichtete Klage der Eheleute vor dem FG war erfolgreich. Das Finanzamt durfte den bestandskräftigen Bescheid nicht ändern. Da ihm die Höhe der gesamten Erstattung bekannt gewesen sei, sei keine Änderung des Bescheids wegen neuer Tatsachen möglich. Das Finanzamt sei bei Veranlagung verpflichtet gewesen, die ihm bekannten Tatsachen auszuwerten. Und zwar auch dann, wenn es keinen Prüfhinweis durch das Risikomanagementsystem gegeben habe. Auch eine Änderung aufgrund eines Schreibfehlers scheide aus, da das Finanzamt eine Unrichtigkeit aus der Sphäre des Steuerpflichtigen nicht als „eigene Unrichtigkeit“ übernehmen könne, wenn der relevante Besteuerungssachverhalt nicht als prüfungsbedürftig beurteilt worden sei.
Hinweis: Es muss nicht alles richtig sein, was das Finanzamt im späteren Verlauf in einem Bescheid ändert. Wir prüfen solche Änderungen für Sie.
32. Weltweite Steuergerechtigkeit:
EU aktualisiert Liste unkooperativer Länder
Um verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich weltweit zu fördern, veröffentlicht die EU zweimal im Jahr eine Liste nichtkooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke. Enthalten sind darin Länder, die bei Steuertransparenz, Steuergerechtigkeit und der Umsetzung internationaler Standards hinterherhinken. In die neue Fassung der Liste wurden nun die Länder Antigua und Barbuda, Belize und die Seychellen als unkooperative Staaten hinzugefügt. Bei allen drei Ländern wurde festgestellt, dass der Austausch von Steuerinformationen unzureichend ist. Weiterhin enthalten sind in der Liste zudem die folgenden Länder und Gebiete:
- Amerikanische Jungferninseln
- Amerikanisch-Samoa
- Anguilla
- Bahamas
- Fidschi
- Guam
- Palau
- Panama
- Russland
- Samoa
- Trinidad und Tobago
- Turks- und Caicosinseln
- Vanuatu
Nicht länger als unkooperativ eingestuft sind die Britischen Jungferninseln, Costa Rica und die Marshallinseln. Diese Staaten haben diverse Maßnahmen ergriffen und beispielsweise ihren Rahmen für den Informationsaustausch auf Ersuchen überarbeitet oder Regelungen zur Freistellung ausländischer Einkünfte geändert.
33. Katastrophenerlass in Schleswig-Holstein:
Steuererleichterungen für Flutopfer
Durch Unwetterereignisse am 20. und 21.10.2023 sind in Schleswig-Holstein beträchtliche Schäden entstanden. Die Schadensbeseitigung wird bei vielen Steuerpflichtigen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. Mit Zustimmung des Bundesfinanzministeriums hat das Finanzministerium Schleswig-Holstein in diesem Zusammenhang einen sogenannten Katastrophenerlass herausgegeben, um die finanziellen Belastungen für die Betroffenen tragbar zu machen.
Darin sind verschiedene steuerliche Maßnahmen zur Vermeidung unbilliger Härten enthalten. Es sind Erleichterungen für alle Betroffenen (sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen) vorgesehen. Anspruchsberechtigt sind im Sinne des Erlasses Geschädigte, die von dem Schadensereignis nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind. Dies gilt gleichermaßen für natürliche wie für juristische Personen, Personenvereinigungen und Vermögensmassen.
Der Erlass sieht Erleichterungen wie zum Beispiel Stundungen und das Aufschieben von Vollstreckungsmaßnahmen vor. Geschädigte können die Stundung der bis zum 31.01.2024 fälligen Steuern beantragen (Einkommen -, Körperschaft- und Umsatzsteuer). Die Stundung ist für drei Monate und längstens bis zum 30.04.2024 zu gewähren. Zudem soll bis zum 30.04.2024 die Vollstreckung bei allen oben genannten bis zum 31.01.2024 fälligen Steuern einstweilen
eingestellt werden. Die im Zeitraum vom 20.10.2023 bis zum 30.04.2024 verwirkten Säumniszuschläge sind grundsätzlich zu erlassen.
Hinweis: Sind durch das Unwetter Buchführungsunterlagen vernichtet worden, so sind hieraus steuerlich keine nachteiligen Folgerungen zu ziehen. Betroffene sollten den Tatbestand der Vernichtung zeitnah dokumentieren.
34. Internationaler Informationsaustausch:
Schweiz offenbart 3,6 Millionen Finanzkonten an Partnerstaaten
Die Zeiten, in denen Schweizer Bankkonten vor ausländischen Finanzverwaltungen verborgen blieben, sind schon
lange vorbei. Die Schweiz hat sich mittlerweile zur Übernahme des globalen Standards für den internationalen
automatischen Informationsaustausch in Steuersachen bekannt. Die gesetzlichen Grundlagen für die Umsetzung des
automatischen Informationsaustauschs (AIA) sind in der Schweiz bereits am 01.01.2017 in Kraft getreten.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat nun bekanntgegeben, dass sie im Jahr 2023 mit 104 Staaten Informationen über Finanzkonten ausgetauscht hat. Zu den 101 bisherigen Staaten – darunter auch Deutschland – kamen nun Kasachstan, die Malediven und der Oman hinzu. Mit 78 Staaten (darunter auch Deutschland) tauschte die Schweiz die Daten gegenseitig aus. Von 25 Staaten erhielt die Schweiz Informationen, versandte jedoch keine, weil die Staaten entweder die internationalen Anforderungen an die Vertraulichkeit und Datensicherheit noch nicht erfüllen oder auf eine Datenlieferung freiwillig verzichten. Mit Russland wurden auch 2023 keine Daten ausgetauscht.
Die ESTV hat Informationen zu rund 3,6 Millionen Finanzkonten an die Partnerstaaten versandt und erhielt von ihnen im Gegenzug Informationen zu rund 2,9 Millionen Finanzkonten. Zum Umfang der dabei erfassten Finanzvermögen machte die ESTV keine Angaben.
Hinweis: Ausgetauscht werden Identifizierungs-, Konto- und Finanzinformationen, darunter der Name, die Anschrift, der Ansässigkeitsstaat und die Steueridentifikationsnummer des Anlegers, sowie Angaben zum meldenden Finanzinstitut, der Kontosaldo und die Kapitaleinkommen.
35. Mobile Banking:
Kontoauszüge sollten regelmäßig gesichert werden
Bankgeschäfte werden heutzutage immer häufiger per Smartphone oder PC abgewickelt. Die Kontoauszüge werden von den Kreditinstituten zwar regelmäßig in die elektronischen Postfächer des Online-Bankings eingestellt, viele Bankkunden ersparen sich aber das Archivieren oder Ausdrucken – manchmal bewusst, oft auch eher unbewusst. Der Effekt: Irgendwann lassen sich die digitalen Auszüge nicht mehr im Online-Banking-Portal abrufen und der Bankkunde steht erst einmal ohne Kontoauszug dar. Der Grund ist, dass die Banken die Kontoauszüge nur für eine begrenzte Zeit in den Kundenpostfächern zur Verfügung stellen. Je Institut variieren die Bereitstellungszeiten von 90 Tagen bis 365 Tage. Spätestens bei der Steuererklärung kann dies zum Problem werden, wenn das Finanzamt einen Zahlungsnachweis
einfordert.
Privatpersonen sollten ihre Kontoauszüge mindestens sechs Jahre aufbewahren, besser noch zehn Jahre. Bankkunden sind daher gut beraten, wenn sie ihre Kontoauszüge monatlich ausdrucken. Wer sich den Ausdruck aus dem Online-Banking sparen möchte, sollte seine Kontoauszüge zumindest digital in einem Ordner speichern bzw. archivieren, so dass sie zur späteren Durchsicht, zum Ausdruck oder zum digitalen Versand zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen. Auf Nummer sicher geht, wer die heruntergeladenen Dateien auf mehreren Speichermedien sichert (z.B. zusätzlich auf USB-Stick).
Hinweis: Zwar sind Banken nach dem Handelsgesetzbuch verpflichtet, Dokumente für zehn Jahre zu archivieren. Möchte ein Kunde aber alte Kontoauszüge nachträglich ausgestellt haben, ist dieser Prozess nicht nur zeitaufwendig, sondern auch mit Gebühren verbunden – einzelne Kontoauszüge werden mit 4 € bis 15 € berechnet. Bankkunden sollten sich daher besser ihr eigenes Archiv anlegen.
| Steuertermine | ||
| Januar 2024 | Februar 2024 | März 2024 |
| 10.01. (*15.01.) | 12.02. (*15.02.) | 11.03. (*14.03.) |
| Umsatzsteuer (Monats-/Quartalszahler) | Umsatzsteuer (Monatszahler) | Umsatzsteuer (Monatszahler) |
| zzgl. 1/11 der Vorjahressteuer bei Dauerfristverlängerung | ||
| Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monats-/Quartalszahler) | Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler) | Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt (Monatszahler) |
| Einkommensteuer mit SolZ u. KiSt (Vorauszahlung) | ||
| Körperschaftsteuer mit SolZ (Vorauszahlung) | ||
| 15.02. (19.02.) | ||
| Gewerbesteuer Grundsteuer | ||
| 29.01. | 27.02. | 26.03. |
| Sozialversicherungsbeiträge | Sozialversicherungsbeiträge | Sozialversicherungsbeiträge |
| * Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt. | ||
| Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den behandelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt. | ||